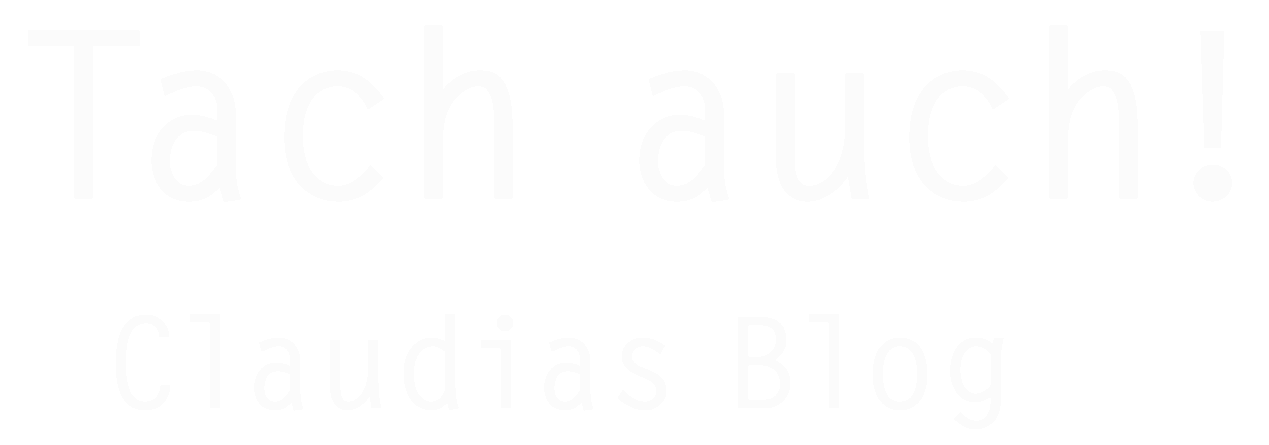Vor einiger Zeit las ich einen Artikel, der die These aufstellte, dass es das Asperger-Syndrom bzw. den hochfunktionalen Bereich des Autismus-Spektrums gar nicht gibt. (Zur Erinnerung: Bevor 2013 im DSM-5 die Unterteilung in Autismus-Subtypen zugunsten der Autismus-Spektrum-Störung aufgegeben wurde, um die verschiedenen Autismus-Schattierungen besser abbilden zu können, galt das Asperger-Syndrom als hochfunktionaler Subtyp des Autismus, während das Kanner-Syndrom als schwerwiegende und stark einschränkende Ausprägung klassifiziert wurde.) Laut Meinung des Autors sei es zweifelhaft, ob diese »leichte« Form des Autismus genügend Krankheitswert besäße, um eine Diagnose zu rechtfertigen. Selbst der Erstbeschreiber des nach ihm benannten Subtyps, der österreichische Kinderarzt und Heilpädagoge Hans Asperger, hätte die Besonderheiten der von ihm beobachteten Kinder eher als Charaktermerkmale innerhalb der normalen menschlichen Bandbreite angesehen denn als Störung. Er war sogar der Meinung, dass für Erfolg in der Wissenschaft oder in der Kunst ein Schuss Autismus erforderlich sei.
Tatsächlich stand seit 1943, dem Jahr, in dem sowohl Hans Asperger als auch Leo Kanner ihre Beobachtungen erstmals beschrieben, in der Forschung aus verschiedenen Gründen lange die schwere Form des Autismus im Vordergrund. Das änderte sich erst, als Lorna Wing, eine britische Psychiaterin, nach 1981 Aspergers Arbeit wieder aufgriff und fortführte. Sie prägte den Begriff Asperger-Syndrom und beschrieb damit ein Störungsbild, das zwar mit dem frühkindlichen oder Kanner-Autismus verwandt, aber von diesem deutlich zu unterscheiden war. Als im Laufe der Zeit dann immer mehr Überschneidungen zwischen den beiden Subtypen dokumentiert wurden und die Klassifizierungen nicht mehr haltbar waren, einigte sich die Wisschenschaftsgemeinde auf den Begriff Autismus-Spektrum-Störung, der dann auch ins DSM-5 einging.
Mittlerweile gibt es also nur noch die Autismus-Spektrum-Störung. Sie gilt als tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich in verschiedenen Schweregraden manifestiert. Die Ausprägungen reichen dabei von geringfügigen bis zu schwersten Beeinträchtigungen. Es gibt nichtsprechende Autisten, die intelligenzgemindert sind und ohne fremde Hilfe nicht überleben könnten. Es gibt solche, die nicht sprechen, aber nicht intelligenzgemindert sind und anderweitig kommunizieren, bspw. über Computer. Es gibt welche, die sprechen, aber intelligenzgemindert sind und mehr oder weniger Unterstützungsbedarf haben. Und dann gibt es noch die, die sprechen, eine normale bis hohe Intelligenz besitzen und (scheinbar) wenig Hilfe benötigen. Die Diagnosezahlen bei letztgenannter Gruppe nehmen seit den 1980er Jahren stetig zu. So sehr, dass von einer Epidemie, einem Hype oder einer Modediagnose gesprochen wird. Ist da etwas dran?
Mir persönlich sind Diagnosen schnurzpiepegal. Eigentlich. Das Problem ist allerdings folgendes: Wer in deutschen Landen psychologische Hilfe benötigt, braucht eine Diagnose. Ohne Diagnose gibt es meist: nichts. Niente. Nada. Ich wurde zu einer Zeit geboren, als noch niemand über Autismus geredet hat. Und falls doch, dann sprach man über Menschen, die nicht kommunizierten und schaukelnd in der Ecke saßen. Hatte ich Probleme? Klaro. Aber nicht solche. Andere. Schon im Kindergarten spielte ich nicht mit meinen Kamerad:innen, wollte nicht basteln, nicht im Stuhlkreis sitzen, blieb für mich allein – und heulte. Oft und ausdauernd. Weil ich mit den Menschen im Speziellen und den vielen Reizen der mich umgebenden Welt im Allgemeinen überfordert war. Deswegen musste ich irgendwann auch nicht mehr hin. Ich lebte fortan zu Hause in meiner heilen, sicheren Welt, fantasierte mich in meine Paraleluniversen, zeichnete ausdrucksstarke Bilder, improvisierte Melodien auf dem Klavier und rannte, gefangen in meinen Gedanken, ausdauernd im Kreis. Bis meine Mutter mich stoppte. Überhaupt, meine Mutter. Ich machte ihr das Leben schwer. Mich ereilten unerklärliche Müdigkeitsattacken bei Tätigkeiten wie aufräumen, anziehen, waschen. Ich bekam Wutanfälle, wenn ich nicht durfte, wie ich wollte, bspw. Lassie auf dem Töpfchen sitzend im Fernsehen schauen. Oder im Winter mit Kniestrümpfen nach draußen gehen. Oder nicht an der Hand bleiben, wenn ich mit meinen Eltern draußen unterwegs war. Ich malträtierte die Tür meines Zimmers, in das mich meine von den Tobsuchtsanfällen völlig überforderte Mutter gesperrt hatte, so lange mit meinen Füßen, bis die Schuhe kaputt waren. Ich aß nur, wenn man mir Geschichten erzählte und auch dann nur bestimmte Lebensmittel, manche verweigerte ich komplett. Ich liebte meinen Teddy, meine Buntstifte und das Klavier unserer Vermieterin. Alles wäre gut gewesen, hätte ich nicht zur Schule gemusst. Doch vor der konnte ich mich nicht drücken. Und da lief es, wer hätte es gedacht, nach meinem Eintritt nicht wirklich gut. Im Grunde hatte ich wieder die gleichen Probleme, nur dass jetzt noch Legasthenie und ADHS hinzukamen. Was damals auch noch kaum einer kannte. Meine Lehrerin jedenfalls nicht. Sie war der Meinung, dass ich besser an einer Sonderschule – so nannte man eine Förderschule damals – aufgehoben wäre, weil ich im letzten Drittel der ersten Klasse zwar wunderbar Buchstaben malen, aber weder ein Wort richtig schreiben noch Lesen konnte und offensichtlich zurückgeblieben war. Dass sie versagt hatte, weil sie mich, still und gut im Auswendigbehalten von Gehörtem, wie ich war, übersehen hatte? Geschenkt. Meine Mutter war bezüglich der Sonderschule anderer Meinung und rettete mich, indem sie mir zu Hause unter Tränen und Geschrei in wenigen Wochen selbst das Lesen und Schreiben beibrachte. Nachdem ich in die zweite Klasse versetzt worden war, wurde manches besser. Ich hatte sogar eine Freundin. Und mehrere Spielkameradinnen. Wie ich zu denen gekommen war? Keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, wie man Freund:innen findet. Meine Freund:innen fanden mich. Ausnahmslos.
In der Realschule ging das Spiel dann wieder von vorne los. Erst als ich in der siebten Klasse wegen einer Lungenentzündung für sechs Wochen das Bett hüten musste und exzessiv zu lesen begann, wurde es besser, weil ich durch die Bücherfresserei meine Legasthenie kompensierte. In der zehnten Klasse war ich dann so gut, dass ich erwog, auf ein Gymnasium zu wechseln. Ich wollte unbedingt weiter lernen, um dann später zu studieren. Am besten etwas, bei dem ich mein Schreib- und Zeichentalent einbringen konnte. Eine Ausbildung, wie sie die anderen Mädchen meiner Klasse anstrebten, kam für mich nicht in Frage. Aber die Schule sah das anders. Das Gymnasium sei zu schwer für mich. Ich solle doch besser einen soliden Beruf erlernen. Deshalb gaben sie mir auch nicht das Empfehlungsschreiben, dass ich zur Anmeldung am Gymnasium gebraucht hätte. Doch wenn ich etwas will, kann ich stur sein. Also machte ich eine Aufnahmeprüfung an meinem Wunschgymnasium. Und wurde angenommen.
Ich hatte noch viele weitere Herausforderungen in meinem Leben zu bewältigen, wurde, naiv wie ich war, gemobbt, missbraucht und ausgenutzt. Aber ich schaffte es, mir meine Nische zu erkämpfen. Ich machte Abitur, studierte Grafik-Design und arbeitete in Werbeagenturen, wo ich gutes Geld verdiente. Später, als mein Sohn die Arbeit dort unmöglich machte, begann ich damit, Bücher zu schreiben und zu illustrieren, für Erwachsene und Kinder. Ich kämpfte darum, dass mein Sohn, der schon früh ähnliche Probleme bekam wie ich seinerzeit, ebenfalls seinen Platz finden konnte. Das und noch einiges andere war aufreibend und brachte mir mehrere Zusammenbrüche samt schwerer Depressionen ein.
Ich wusste immer, dass ich anders bin. Als Kind sah ich, wie die Mädchen, die ich kannte, mit Leichtigkeit unter ihresgleichen agierten und verstand nicht, wie sie das machten. Sie schienen nach Regeln zu handeln, die ich nicht kannte. Also lernte ich, mein Verhalten an mein soziales Umfeld anzupassen. Ich war – und bin – eine ausgezeichnete Beobachterin. Und ich besitze einen scharfen Verstand. Der erwies mir gute Dienste dabei, das menschliche Miteinander zu durchleuchten, denn der Sinn hinter vielen Umgangsformen blieb mir lange, teilweise bis ins Erwachsenenleben hinein, schleierhaft. Ich trainierte mir Verhaltensmuster an, die ich mir von anderen abschaute, spielte den jeweiligen Umständen angepasste Rollen, entwickelte ein Verständnis für Witz und Ironie. Aber das alles war anstrengend. Extrem anstrengen. Und ist es bis heute geblieben. Trotz des ganzen Aufwands verstehe ich die Menschen manchmal immer noch nicht. Komme mit der Ironie mir unbekannter Personen nicht klar. Nehme Aufforderungen wörtlich und irritiere damit mein Umfeld. Hasse es, mich in größeren Menschengruppen zu bewegen. Bin durch Gerüche, Geräusche, Berührungen, Lichter und Gefühle – meine und die anderer – schnell überlastet etc. Und möchte dennoch meinen Autismus nicht missen, denn er bringt, neben den Nachteilen, auch immense Vorteile mit sich. Ich nehme Details wahr, die den meisten Menschen entgehen und erkenne dadurch schnell Fehler. Ich denke in sich vernetzenden Bildern und finde auf diese Weise Lösungen für Probleme, die anderen nicht einfallen. Meine ausufernde Fantasie macht mich auf ungewöhnliche Weise kreativ, während mein Bedürfnis nach Struktur mir hilft, die vielen Ideen zu sortieren und mit autistischer Sturheit zielgerichtet in die Tat umzusetzen.
Warum ich die Autismus-Diagnose angestrebt habe? Weil ich endlich wissen wollte, warum ich so anders bin. Und weil ich dringend Hilfe brauchte. Ein Einzelkämpfer:innendasein funktioniert nur, so lange man kämpfen kann. Ich konnte es irgendwann nicht mehr.
Habe ich deswegen jetzt eine Modediagnose?
Nein. Nur weil mein Anderssein nach außen hin für neurotypische Menschen wenig sichtbar ist, verschwindet es nicht einfach. Und die Probleme, die durch den gesellschaftlichen Anpassungsdruck entstehen, auch nicht. Was ich mich oft frage: Wie viele Frauen in meinem Alter und ähnlichen Schwierigkeiten gibt es noch da draußen? Das Geschlechterverhältnis liegt, je nach Studie, zwischen 17:1 und 2:1 zugunsten der Männer. Doch Frauen fielen schon immer gerne durchs medizinische Raster, ganz besonders bei der Autismusdiagnostik, die sich bis heute meist an männlich geprägten Stereotypen orientiert. Manche Frau, die ihre Nische gefunden hat und gut darin lebt, braucht vielleicht keine Diagnose. Das gilt natürlich auch für die angepassten Männer. Aber bei vielen Älteren, in deren Jugend es noch kein Wissen über Autismus gab, ist das anders. Sie hatten – und haben meist auch heute noch – Probleme, die ihnen das Leben schwer machen und bei denen ihnen bisher niemand adäquat helfen konnte. Doch seit 1993 gibt es das Internet und mit ihm immer mehr Forenbeiträge und YouTube-Videos zum Thema Autismus. Und auf einmal finden sich diese Personen in den Beschreibungen der anderen wieder. Und streben eine Diagnose an, um endlich die Hilfe zu finden, die sie schon immer gebraucht hätten.
Wer entscheidet, wann etwas Krankheitswert hat? Die Person, die leidet, sei es auch nach außen wenig sichtbar, oder der Arzt, der sie diagnostizieren soll? Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, ist klar, dass hier etwas nicht stimmt und der Mensch Hilfe braucht. Es würde niemandem einfallen, darüber zu diskutieren. Aber bei den »unsichtbaren« Krankheiten, zu denen ich alle psychischen Erkrankungen (Depressionen, Zwangs-, Angststörungen etc.) sowie Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen zähle, sieht das schon anders aus. Von außen sind sie nicht immer leicht zu erkennen, weil sie sich dort meist nur über mehr oder weniger starke Verhaltensauffälligkeiten äußern. Wie es im Innern einer Person aussieht, können Diagnostiker:innen lediglich über strukturierte Interviews und/oder Fragebögen herausfinden. Weicht sowohl das Verhalten als auch das innere Erleben der begutachteten Person sehr weit von gesellschaftlichen Normen ab und führt zu Leid und/oder Beeinträchtigungen im Alltag, so wird eine Krankheitswert festgestellt und eine Diagnose vergeben. Das kling alles einleuchtend und gut umsetzbar. Doch das ist es leider oft nicht. Es gibt bei der Diagnosenstellung große Ermessensspielräume. Die eine Ärztin schaut hauptsächlich auf die Verhaltensabweichungen, der andere Diagnostiker legt mehr Wert auf die innere Problematik. Was für die eine Untersucherin bereits eine Beeinträchtigung darstellt, ist es für einen anderen Mediziner noch nicht. Wo liegt die Grenze zum »Normverhalten«? Und wie misst man Leid? Was, wenn eine Person sich mühsam gesellschaftlich erwünschtes Verhalten antrainiert hat und daher äußerlich nicht auffällt, aber durch die dauerhafte Anstrengung, nur ja nichts falsch zu machen, ständig überlastet ist und immer wieder im Burnout landet? Was, wenn eine Person nicht in der Lage ist, ihre inneren Zustände adäquat zu beschreiben? Was, wenn die eigene Bewertungsskala einen anderen Maßstab hat als die der Diagnsotikerin? Oder die Chemie mit dem Arzt so gar nicht passt? Autismus bei hoch maskierenden Erwachsenen festzustellen, ist alles andere als einfach und benötigt umfängliches Wissen und viel Erfahrung auf Seiten der untersuchenden Person. Dennoch kann es zu Fehleinschätzungen kommen, sowohl in die eine als in die andere Richtung. Gerade bei Frauen und Mädchen gibt es sicher auch heute noch viele falsch-negative Diagnosen. Ich persönlich denke, dass ein hohes Dunkelfeld existiert. Nicht alle Menschen mit autismustypischen Problemen suchen Hilfe. Vielleicht, weil sie viele schlechte Erfahrungen im medizinischen Bereich machen mussten. Oder weil sie nur die stereotypen Bilder von Autismus im Kopf haben. Womöglich auch, weil sie eine Stigmatisierung durch die Diagnose vermeiden wollen. Oder weil sie es für sich ablehnen, an einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung zu leiden.
Modediagnose. Dieses Wort impliziert, dass es schick ist, Autismus zu haben. Doch was soll toll daran sein, an einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung zu leiden? Die Probleme beim sozialen Miteinander? Keine oder nur wenige Freunde zu haben? Ein durch das ausgeprägte Bedürfnis nach struktureller Sicherheit stark eingeschränktes Alltagsleben? Nur einen unpassenden oder gar keinen Job zu bekommen? Die ständige Überlastung durch viel zu viele Reize? Dauerhaft von autistischem Burnout und Depressionen bedroht zu sein? Nie dazuzugehören, immer Außenseiter:in zu sein oder der seltsame Freak?
Die Welt heute verändert sich schneller und produziert mehr Reize als noch vor ein paar Jahrzehnten. Auch das mag ein Grund dafür sein, dass ein Mensch mit autistischer Veranlagung gegenwärtig eher an seine Grenzen stößt und Hilfe sucht. Außerdem hat das Wissen über die vielen verschiedenen Erscheinungsformen des Autismus, vor allem die weiblichen, bei Ärzten und Therapeuten in den letzten Jahren zugenommen, sodass mehr Personen erkannt werden. Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Zahl der autistischen Menschen verändert hat. Sie sind mittlerweile nur sichtbarer. Und das ist gut so.
Heute gehen Schätzungen davon aus, das ca. zwanzig Prozent der Weltbevölkerung neurodivergent sind, also anders verdrahtete Gehirne besitzen. Es geht um Autist:innen, ADHSler:innen, Personen mit Legasthenie, Dyskalkulie, Dyspraxie, Tourette, bipolarer Störung, Synästhesie, Hochsensibilität und Hochbegabung. Ich bin mir nicht sicher, ob bei obiger Schätzung berücksichtig wurde, dass sehr viele neurodivergente Menschen nicht nur eine Besonderheit, sondern häufig zwei, drei oder noch mehr aufweisen, es ist also nicht so, dass man einfach die Diagnosezahlen zusammenrechnen kann. Bei mir bspw. kommen Autismus, ADHS, Hochsensibilität, Legasthenie und Hochbegabung zusammen. Wobei Hochsensibilität in unterschiedlichster Ausprägung ja ein Thema bei eigentlich allen neurodivergenten Menschen ist, wie ich bereits in meinem Blog-Beitrag »Hochsensibel, ADHS oder doch Autismus?« beschrieben habe.
Hier ein paar Zahlen: Ca. zwei Prozent der Menschen haben Autismus, je ca. fünf Prozent ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie, Dyspraxie, ca. ein Prozent haben Tourette, ca. drei Prozent eine bipolare Störung, ca. vier Prozent Synästhesien, ca. zehn Prozent (in manchen Studien bis zu 30 Prozent!) sind hochsensibel, ca. zwei Prozent hochbegabt. So gesehen sind neurodivergente Menschen, egal ob man nun von einem zehn-, zwanzig- oder dreißigprozentigen Anteil an der Gesamtbevölkerung ausgeht, eine Minderheit. Eine Minderheit, die mittlerweile sehr laut Aufmerksamkeit, Verständnis und Unterstützung einfordert. Und das ist gut so. Die Zeiten, in denen die schwierigen Kinder, die schwarzen Schafe der Familie, die Behinderten, die Seltsamen, die Andersartigen abgeschoben wurden in Förderschulen, Heime und psychiatrische Einrichtungen, wo sie die Allgemeinheit nicht störten, sind zum Glück (fast) vorbei. Nur wer früher in begüterten Verhältnissen aufwuchs und verständnisvolle und unterstützende Eltern hatte, fand meist einen Platz in der Gesellschaft, häufig sogar einen angesehenen. Wie Pablo Picasso beispielsweise, der lange wegen seiner Legasthenie nicht lesen und schreiben konnte, dafür aber ausgezeichnet malte und zeichnete. Seine Eltern ermutigten ihn, sich der Kunst zu widmen und förderten ihn, wo sie nur konnten, sodass er sein Talent leben und ein berühmter Künstler werden konnte. Oder der schwerhörige und vermutlich autistische Thomas Edison, dessen Lehrer ihn für geistig behindert hielt. Er wurde, nachdem er die Schule verlassen musste, zu Hause von seiner Mutter unterrichtet und entwickelte sich zu einem überaus erfolgreichen Erfinder. Oder Temple Grandin, der Mediziner schon früh einen Hirnschaden attestierten und die erst mit vier Jahren zu sprechen begann. Ihre Eltern förderten sie umfassend, obwohl die Ärzte empfohlen hatten, die Tochter in ein Heim zu geben. So konnte sie studieren, einen Doktortitel erwerben und eine erfolgreiche Karriere als Wissenschaftlerin und Dozentin machen.
Heute scheint es für Menschen, die anders sind, leichter zu sein als früher. Ihre Themen werden durch differenzierte Berichterstattung in den öffentlichen Diskurs gebracht und die gesellschaftliche Teilhabe durch umfängliche Forschung, einfacher zugängliche Diagnostik und vielfältige Unterstützung erleichtert. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Andererseits geistern viele unausrottbare Vorurteile durch die Medien (Autist:innen haben keine Gefühle, ADHSler:innen sind Chaoten), die Wartelisten der Diagnostikstellen werden lang und länger, weil es zu wenig Spezialisten gibt, und gesellschaftliche Teilhabe ist durch Ablehnung, Ängste und mangelndes Verständnis oft stark erschwert. Es wird zwar viel über neurodivergente Menschen geredet, aber zu wenig mit ihnen. Sichtbarkeit bedeutet eben nicht, dass alle Probleme sich von jetzt auf gleich in Luft auflösen, ganz im Gegenteil. Sichtbarkeit bedeutet auch, dass sich mehr und mehr selbsternannte Autist:innen in den sozialen Medien tummeln, die leider keine Ahnung davon haben, was Autismus wirklich ist. Und ich meine nicht die Menschen mit wirklichen Problemen, die nach umfänglicher Recherche und Vergleichen mit Betroffenen feststellen, dass sie vermutlich ins Spektrum gehören und eine Abklärung anstreben, um endlich Hilfe zu bekommen. Ich meine ausdrücklich jene, die weder unter irgendwelchen Einschränkungen leiden, noch eine Diagnostik wollen, aber überall ihren Senf dazugeben müssen, weil sie sich autistisch »fühlen«. Vermutlich sind sie ein Grund dafür, dass so viel von Modediagnose und Hyp geredet wird.
Jede Person, die heute eine Diagnostik anstrebt, sei es wegen des Verdachts auf Autismus, ADHS oder sonst etwas, macht das nicht aus Spaß oder weil sie sich halt so fühlt, sondern weil sie einen Leidensdruck verspürt. Und jeder Mensch, der eine Diagnose erhält, bekommt sie nicht, weil sie gerade so angesagt ist. Wer Hilfe sucht, sollte sie kriegen. Punkt. Ganz ehrlich: Das Wort Modediagnose macht mich wütend. Sehr wütend.
Quellen:
- Steve Silberman: Geniale Störung. Die geheime Geschichte des Autismus und warum wir Menschen bauchen, die anders denken, DuMont Buchverlag, Köln, 2016
- https://www.autismusspektrum.info/post/autismus-ist-nicht-die-norm-was-mich-am-modeautismus-stört
- https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/autismus-neurologie-trend-101.html
- https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Gibt-es-das-Asperger-Syndrom-ueberhaupt-402658.html
- https://www.asperger-rhein-main.de/asperger.html
- https://www.spektrum.de/news/genderbias-warum-frauen-in-autismus-studien-unterrepraesentiert-sind/2080464