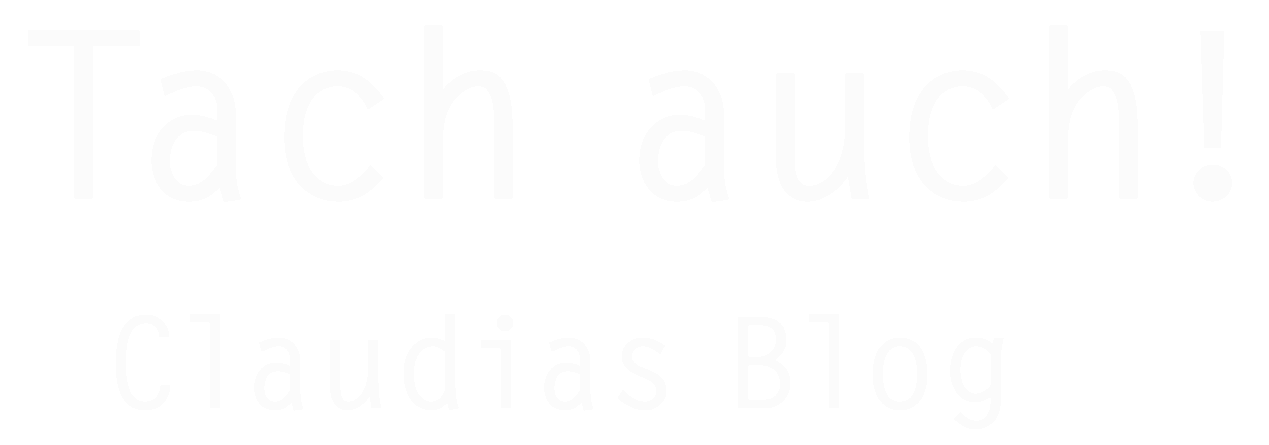Neulich wollte ich in meiner Schreibgruppe eine Kurzgeschichte vortragen, die ich zu Beginn des Ukrainekriegs geschrieben und dann einige Male überarbeitet hatte, ohne mit dem Ende zufrieden zu sein. Vor kurzem nahm ich mir den Text noch einmal vor und wollte nun das Ergebnis den Anwesenden vorstellen.
Ich begann ohne irgendwelche Vorbemerkungen zu lesen. Die Geschichte taucht direkt in die Situation ein, es geht um einen alten Ukrainer, der auf die plündernden Russen wartet, um, wenn er stirbt, wenigstens noch einen von ihnen mit in den Tod zu nehmen. Und es dann doch nicht kann. Ich schreibe in der Regel nach dem Motto: Show, don’t tell.
Nachdem ich etwa eine Minute gelesen hatte, wurde ich von der Gruppenleitung unterbrochen mit dem Hinweis, dass ich keine Triggerwarung angebracht hätte, obwohl hier Themen angesprochen würden, die verstören könnten. Nach einer kurzen Pause sollte von allen entschieden werden, ob sie den Text hören wollten oder nicht.
Ich fiel aus allen Wolken. Klar, es geht in der Geschichte um den Krieg in der Ukraine, aber darüber wird tagtäglich in den Nachrichten berichtet. Mir war nicht bewusst, dass sich irgendjemand durch eine Geschichte zu diesem Thema getriggert fühlen könnte. Mein Fehler. Dachte ich zumindest in diesem Moment. Schließlich hatte ich doch selbst viele Jahre lang höchst sensibel auf bestimmte Themen reagiert, bspw. Grausamkeit, Ungerechtigkeit und alles, was mich an meine eigene Geschichte erinnerte. Dann wurde mir klar, dass mich die immer wiederkehrende Konfrontation mit den belastenden Inhalten dazu gezwungen hatte, mich intensiv mit dem, was mich fertig machte, auseinanderzusetzen und einen Umgang damit zu finden. Was mich wiederum weitergebracht hatte. Weiter jedenfalls, als wenn ich die Beschäftigung damit vermieden hätte. Zwar reagiere ich immer noch angefasst auf diese Themen, aber nicht mehr mit Tränenausbrüchen und quälender innerer Not. Es gelingt mir mittlerweile deutlich besser, mich innerlich von dem, was ich da gerade sehe, höre oder lese, zu distanzieren. Therapeut:innen werden jetzt vermutlich mit dem Kopf nicken, denn das Konzept ist ihnen bestens bekannt. Es nennt sich Konfrontationstherapie. Hierbei werden traumatisierte Menschen oder solche, die unter Ängsten und Zwängen leiden, durch ihre Therapeut:in behutsam und in zunehmender Intensität an ihre traumatischen Trigger bzw. die auslösenden Ängste herangeführt und so langsam desensibilisiert.
Der Begriff Trigger (Auslöser, englisch trigger) kommt ursprünglich aus der Traumatheorie und bezeichnet mögliche Auslösereize, ist aber mittlerweile in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und wird inflationär für alles mögliche verwendet. Was zur Folge hat, dass seine Bedeutung stark verwässert wurde. Heute ist jeder von irgendwas getriggert. Von der Schwiegermutter, dem Dozenten, der eine drastische Sprache verwendet, dem müffelnden Obdachlosen oder dem Schweinetransporter auf der Autobahn. Trigger sind immer ausgesprochen individuell. Was die Frage aufwirft, wie vor dieser Flut an »schlimmen Dingen« überhaupt adäquat gewarnt werden kann. Schließlich ist es kaum möglich, bei jeder Art von Veröffentlichung vorab kilometerlange Listen mit möglichen Triggern zu setzen. Das würde vermutlich auf Dauer nur dazu führen, dass die Warnungen niemanden mehr interessieren und sie so ihren Zweck verfehlen. Andererseits ist es natürlich eine schöne, von Empathie zeugende Geste, die Ängste sensibler und traumatisierter Menschen ernst zu nehmen und ihnen den Umgang mit ihren persönlichen Triggern durch Warnungen zu erleichtern. Doch erfüllen sie tatsächlich diesen Zweck? Das fragte ich mich nach der oben beschriebenen Erfahrung in meiner Schreibgruppe.
Unser Gehirn funktioniert über Verstärkung. Triggerwarnungen sind perfekte Verstärker. Ihre anhaltende Verwendung kann dazu führen, dass die Themen, vor denen gewarnt wird, für die Zielgruppe stetig an Bedeutung gewinnen und viel wichtiger werden, als sie eigentlich sind. Auf diese Weise werden sich Ängste eher verfestigen als verschwinden. Bei traumatisierten Personen kann es sogar zu einer Überidentifikation mit dem Trauma kommen, weil die Annahme, etwas wirklich Schlimmes erlebt zu haben, durch die ständigen Triggerwarnungen bestätigt (verstärkt) wird und die Person sich dann vermehrt über das Drama definiert, anstatt sich davon zu befreien. Das ist definitiv nicht hilfreich. Eine Meta-Studie von 2023 kam zu dem Schluss, dass Triggerwarnungen die Angstreaktionen nicht dämpfen, selbst wenn das traumatische Erlebnis der Person dem präsentierten Inhalt ähnelt. Sie können sogar bei Menschen mit schwereren Symptomen von PTBS die Angst erhöhen! In diesem Zusammenhang spielen selbsterfüllende Prophezeiungen und Nocebo-Effekte eine große Rolle. Triggerwarnungen implizieren, dass durch diesen Film, dieses Buch, diese Vorlesung möglicherweise Unwohlsein auftreten könnte. Schon stellt es sich de facto ein. Triggerwarnungen lassen also häufig erst die Ängste entstehen, vor denen sie warnen.
Für die meisten Menschen, auch die traumatisierten, scheinen Triggerwarnungen laut Studienlage die Anziehungskraft auf potenziell negatives Material sogar zu erhöhen, anstatt sie zu verringern. Der Mensch ist eben neugierig. Selbst wenn es ihm dann hinterher leid tut. Es lebe der Pandora-Effekt!
Triggerwarnungen machen also gerade die Inhalte anziehend, die von traumatisierten Menschen besser gemieden werden sollten. Außerdem helfen sie nicht dabei, Ängste zu verringern, ganz im Gegenteil. Warum nutzen wir sie dann eigentlich? Das ist eine gute Frage. Mich persönlich jucken die Triggerwarnungen nicht. Meinetwegen soll jeder damit machen was er will. Doch halt, da fällt mir etwas ein: Mit welchen Themen beschäftigen sich Künstler im allgemeinen die meiste Zeit? Mit Bienchen und Blümchen? Oder mit den Dramen des menschlichen Daseins? Kunst ist ja nicht nur hygge oder dient ausschließlich der Erheiterung, sondern will auf Missstände hinweisen, will die echt harten Brocken, die eine Gesellschaft umtreiben, beackern, will nicht in den Arsch kriechen, sondern diesen sprichwörtlich aufreißen. Durch die stetige Ausweitung der Triggerzonen besteht in meinen Augen daher noch eine weitere, viel ernstere Gefahr: Dass nämlich bestimmte Themen aufgrund ihrer Triggergefahr gar nicht mehr in den öffentlichen Diskurs vordringen. Das wäre dann nicht mehr Empathie, sondern Zensur. Und die will wirklich niemand.
Ich habe meinen Text an dem Abend nicht vorgelesen.
Quellen:
- https://doi.org/10.1177/21677026231186625, abgerufen am 3.8.2025
- https://taz.de/Psychologe-ueber-Triggerwarnungen/!5907830/, abgerufen am 4.8.2025
- https://www.swr.de/leben/gesundheit/wie-sinnvoll-sind-triggerwarnungen-100.html, abgerufen am 4.8.2025
- https://www.gwup.org/skeptiker-artikel/sonstiges/achtung-triggerwarnung/ abgerufen am 4.8.2025